Vertrauen im Team – ein Thema, das viele Teamleitungen nur zu gut kennen. Wenn sich Mitarbeitende voneinander distanzieren und kritische Themen unausgesprochen bleiben, wird eine sachlich und effektive Zusammenarbeit fast unmöglich.
Ein starkes Vertrauen im Team bildet die Grundlage für offene Kommunikation, echte Zusammenarbeit und den gemeinsamen Erfolg. Doch dieses Vertrauen entsteht nicht von selbst. Es lässt sich nicht verordnen oder durch Appelle herbeiführen.
In diesem Artikel zeige ich dir anhand einer Fallstudie, wie Vertrauen im Team verloren gehen kann und was notwendig ist, um es nach und nach wieder aufzubauen.
Vertrauensprobleme hängen häufig mit ungelösten Konflikten zusammen oder führen zu solchen. Maßnahmen wie ein Teamfrühstück oder ein Outdoor-Event sind dann eher kontraproduktiv.
Du wirst erfahren, warum es so wichtig ist, Konflikte offen anzusprechen, um Vertrauen im Team zu erhalten oder wieder aufzubauen. Ich gebe dir Handlungsempfehlungen an die Hand, mit denen du die Kommunikationskultur verbessern und eine stabile Vertrauensbasis schaffen kannst.
Der Fall: Wenn Vertrauen im Team fehlt
„Wir brauchen wieder mehr Vertrauen im Team.“ Mit dieser Bitte kam die Leitung eines Teams im Bereich der sozialen Arbeit auf mich zu.*
Die Stimmung im Team war angespannt. Immer wieder suchten Mitarbeitende unter Tränen das Gespräch. Kommunikation war schwierig, Missverständnisse, Überforderung und Stress bestimmten den Arbeitsalltag.
*(Der Fall basiert auf einer realen Erfahrung, wurde jedoch zum Schutz aller Beteiligten anonymisiert.)
Die Vorgeschichte
Im Vorjahr hatte eine Beziehung zwischen dem einzigen Mann im Team und einer Kollegin für Unruhe gesorgt. Anfangs hielten sie die Beziehung geheim, doch bald machten Gerüchte die Runde, bis sie sich schließlich offen dazu bekannten.
Die Reaktionen im Team fielen unterschiedlich aus. Einige Kolleginnen, die eng mit der Frau befreundet waren, sahen kein Problem. „Das ist menschlich, das passiert. Freut euch doch für sie!“ waren ihre Worte. Andere hingegen hielten die Beziehung für unprofessionell.
Trotz der Beteuerungen des Paares, Arbeit und Privatleben gut trennen zu können, schwebte der Verdacht über ihnen, dass sie zu Hause Teamangelegenheiten besprachen. Die Diskussionen darüber lenkten ab und erschwerten die Organisation des Arbeitsalltags und raubten dem Team wertvolle Energie und Aufmerksamkeit.
Die Planung von Urlauben und Arbeitseinsätzen wurde kompliziert.
Grüppchenbildung und Parteilichkeit
Die bis dahin recht offene Kommunikation nahm ab, das Vertrauen im Team begann zu bröckeln. Nur wer sicher war, dass andere die eigene Meinung teilten, sprach sich aus. Es gab immer mehr „Hintenrum“ – als „Vornerum“- Gespräche.
Die Teamleitung versuchte mehrfach, aber erfolglos, mit Appellen gegenzusteuern. Schließlich schaltete sie die Geschäftsführung ein, doch auch das brachte keine Verbesserung.
Der Träger greift ein
Die Geschäftsführung entschied, dass einer von beiden das Team verlassen müsse. Der Mitarbeiterin wurde eine Versetzung angeboten, sie lehnte jedoch ab, fühlte sich gemobbt und kündigte. Gleichzeitig zerbrach die Beziehung.
Doch das Vertrauen im Team kehrte nicht zurück.
Keine Ruhe nach dem Abschied
Wenige Wochen später zeigte die ehemalige Mitarbeiterin ihren Ex-Partner bei der für den Bereich zuständigen Behörde an. Die Untersuchung verunsicherte das Team weiter. Einige suchten gezielt nach Fehlern, andere stellten sich hinter ihn.
Die Behörde konnte kein Fehlverhalten feststellen, sprach aber Auflagen aus. Die Teamleitung sollte ein Coaching absolvieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation – und des Vertrauens im Team – ergreifen.
Das Team fühlte sich kontrolliert und zu Unrecht unter Verdacht. Einige waren wütend auf den verbliebenen Mitarbeiter und begannen, ständig nach Fehlern zu suchen. Andere solidarisierten sich mit ihm.
Die Teamleitung und ihr Führungsstil
Hintergrund
Die Leitung hatte ihre Position zwei Jahre zuvor übernommen. Sie ist Pädagogin und wurde wegen ihrer Beliebtheit und Erfahrung ins Amt gehoben, ohne eine Ausbildung im Bereich Führung und Management zu haben. Sie bemüht sich, das Team zu unterstützen. Ihr wird vertraut, da sie zum „Stamm“ gehört und bereits die rechte Hand der vorherigen Leitung war.
Führungsstil
Eine positive Teamatmosphäre ist ihr wichtig, in der sich alle wohlfühlen. Mit ihrer Art bringt sie Ruhe rein und kann gut deeskalieren. Aber sie versteht nicht, warum die getroffenen Vereinbarungen dann einfach nicht funktionieren.
Was sie bisher versucht hat:
- Einzelgespräche mit Mitarbeitenden, täglich – aber nur kurzfristig hilfreich
- Gespräche mit Geschäftsführung – wenig Wirkung
- Teamtag – scheiterte an Themenauswahl
- Betriebsausflug – kein Interesse im Team
Ermüdet von der ständigen Krise, den fehlenden Fortschritten und mit den behördlichen Auflagen vor Augen, suchte sie schließlich nach einer Beratung.
Treten wir jetzt einen Schritt zurück und betrachten die Situation aus einer höheren Perspektive.
Die Vogelperspektive
Hier sehen wir ein Team, das in vielen psychosozialen Arbeitsfeldern typisch ist: Überwiegend Frauen und nur wenige Männer im Team. Oft wird der Eintritt eines Mitarbeiters sehr begrüßt, da ein gemischtes Team häufig als angenehmer und entspannter gilt.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass am Arbeitsplatz Liebesbeziehungen entstehen. Schließlich verbringt man oft mehr Zeit mit den Kolleg:innen als mit Freunden oder der Familie.
Gemeinsame Erfahrungen und Herausforderungen schaffen Nähe!
Doch eine Paarbeziehung innerhalb einer professionellen Organisation bleibt selten rein privat. Sie wird Teil einer übergeordneten Dynamik und beeinflusst die Teamstruktur und -prozesse.
Die gesellschaftliche und kulturelle Auffassung, dass eine Liebesbeziehung per se etwas Schönes und Schützenswertes sei, führt dazu, dass man sich von außen nicht einmischt.
Wie verändert sich die Dynamik?
Das Problem ist jedoch, dass dadurch in einem Team eine exklusive Untergruppe entsteht, die sowohl außerhalb des gemeinsamen Prozesses als auch mitten im Geschehen steht. Dies erschwert es, kritische Themen anzusprechen. Teammitglieder outen sich nicht mehr, und das Paar kann sich unbewusst Diskussionen entziehen, die eigentlich im Team stattfinden sollten.
Unmerklich verschiebt sich der Fokus. Die Aufmerksamkeit liegt ständig auf dem Paar, auch, ohne dass darüber direkt gesprochen wird. Oft wird das Thema zum Tabu, denn es geht schließlich um Liebe! Diese Beziehung lenkt von vielen Arbeitsthemen ab und reduziert die Möglichkeit, offen über aktuelle Herausforderungen zu sprechen.
Emotionen im Spiel
Eine Paarbeziehung im Team kann bei anderen vielschichtige und „schwierige“ Gefühle hervorrufen, über die man selbst im Privatleben ungern spricht – im Arbeitskontext erst recht nicht. Rivalität, Neid, Eifersucht, Unsicherheit und das Gefühl einer subtilen Machtverschiebung im Team können Teammitglieder belasten und ihre Wahrnehmung sowie Kommunikation beeinflussen.
Es ist nicht notwendig, alles offenzulegen, aber wichtig ist, dass die entstehenden Unsicherheiten thematisiert werden können. Das Thema sollte aus der Tabuzone herausgeholt werden
Symptom für ungelöste Konflikte im Team
Eine Paarbeziehung im Team kann, auch wenn das romantischen Vorstellungen widerspricht, ein Symptom dafür sein, dass Konflikte im Team nicht gelöst wurden.
Konflikte sind an sich normal und kein Problem. Zum Problem werden sie, wenn der Austausch nicht mehr möglich ist, wenn nicht mehr alle Stimmen Gehör finden, wenn es keine Phasen der Reibung gibt. Wenn Probleme nicht wirklich bearbeitet werden und alles unter den Teppich gekehrt wird, führt das auf lange Sicht zu destruktiven Dynamiken.
Ein Paar im Team kann als ein Ventil fungieren, auf das sich die gesamte Dynamik verlagert. Dies bedeutet oft, dass die Kommunikation noch mehr abnimmt und Konflikte weiter verdrängt werden.
Natürlich kann das auf Dauer nicht gutgehen.
Polarisierung
In diesem Fall zeigt sich dieses im weiteren Verlauf, bei dem sich alles immer mehr polarisiert und der Konflikt eine immer neue Eskalationsstufe erreicht. Während die Teamleitung „Die Gute“ bleibt, die dem Team nichts zumutet und es schont, übernimmt die Geschäftsführung schließlich die Rolle des „Bad Cops“, indem sie Grenzen zieht und eine Entscheidung herbeiführt.
Die erhitzten Emotionen richten sich gegen die Geschäftsführung, die schließlich mit Vorwürfen des Mobbings konfrontiert wird.
Die zunächst unerklärliche Anzeige der Mitarbeiterin gegen ihren Ex-Partner lässt sich verstehen als ein Ausdruck großer Wut Wut und Aggression. Das Einbeziehen der übergeordneten Behörde wirkt wie der Versuch, eine höhere Instanz einzuführen, die über die Situation Recht sprechen soll.
Eskalation
Um die Eskalation und das Verhalten der Mitarbeiterin besser zu verstehen, bietet das Modell des Konfliktforschers Friedrich Glasl Aufschluss. Er beschreibt neun Stufen der Konflikteskalation, an deren Ende es nur noch „gemeinsam in den Abgrund“ geht.
Die Situation im Team könnte etwa der Stufe 7-8 zugeordnet werden. In dieser Phase handeln die Beteiligten oft irrational. Die Wahrnehmung ist eingeengt und es geht nur noch darum, den Gegner zu schädigen.
Man kann nur spekulieren, was im privaten Raum vorgefallen ist. Die Reaktion spricht für eine tiefe Kränkung. Allein die Tatsache, dass die Geschäftsführung entschieden hat, wer bleibt und wer geht, kann in der Beziehung zu großen Konflikten geführt haben. Möglicherweise hatte die Mitarbeiterin erwartet, dass ihr Partner mit ihr kündigt. Es bleibt unklar, was genau vorgefallen ist und warum er im Team bleiben wollte.
Vielleicht hatte sich ein „Drama-Dreieck“ entwickelt – ein ungesundes Grundmuster in Beziehungen, in dem eine Person aufgrund von Enttäuschungen plötzlich von einer positiven Rolle in die des Täters wechselt.
Ablehnungen von mehreren Seiten können ausreichen, um sich verraten zu fühlen und den Wunsch zu hegen, es allen heimzuzahlen. Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Beziehung zerbricht, wenn sich der Kontext ändert, in dem sie entstanden ist.
Es ist fast unausweichlich, dass irgendwann jemand in die Rolle des „Bad Cops“ schlüpfen muss – in diesem Fall die Geschäftsführung. Sie trifft eine Entscheidung, rutscht damit aber auch in eine Täter–Rolle. Wieder ein Hinweis auf ein Drama – Dreieck.
Teamleitung und auch die Geschäftsführung haben zunächst lange gewartet und alles laufen lassen. Dann funktionieren irgendwann nur noch harte Maßnahmen. So ist es fast unausweichlich, dass sich die angestauten Gefühle gegen die Geschäftsführung richten. Die tiefe Kränkung der Mitarbeiterin und der Mobbingvorwurf sind eine direkte Folge dieser Situation.
Die Rolle der Teamleitung
Die Teamleitung ist engagiert und genießt nach wie vor das Vertrauen des Teams. Das ist zunächst einmal positiv. Doch es gibt einige Aspekte in ihrem Führungsstil, die zur aktuellen Dynamik beitragen.
Der Führungsstil
Wie häufig in psychosozialen Arbeitsfeldern agiert die Teamleitung sehr verständnisvoll, beziehungsorientiert und beratend. Dies ist naheliegend, da es den Kernkompetenzen und Grundwerten von Pädagogen und Pädagoginnen entspricht. Menschlichkeit, Verbindung und Gemeinschaft sind zentrale Begriffe, die oft auch in den Leitbildern der Träger zu finden sind.
In sozialen Arbeitsfeldern erwarten Mitarbeitende häufig, dass alle gut miteinander auskommen. Es sollte eine familiäre oder wohlfühlende Atmosphäre herrschen. Argumentation, Konfrontation und Kritik hingegen sind oft negativ behaftet.
Die persönliche Konfliktstrategie
Die Konfliktstrategie der Teamleitung passt zu diesem Verständnis. Sie versucht, Konflikte „empathisch“ zu lösen, indem sie einfühlsam ist, Friedensappelle macht und nach Kompromissen strebt. Ärger und Aggression im Team erzeugen in ihr Stress und Unruhe.
Sie hat dann das Gefühl, dass etwas grundsätzlich nicht stimmt. Daher neigt sie dazu, zügig auf einen Kompromiss hinzuarbeiten. Zwar bringt sie in schwierigen Momenten Beruhigung in die Situation, doch die Lösungen bleiben oft an der Oberfläche. Sie sind nicht im Rahmen eines gemeinsamen Prozesses erstritten und die Konflikte tauchen daher wieder auf.
(Hier findest du mehr zu den grundlegenden Konfliktstrategien).
Die Analyse zusammengefasst
- Die Kommunikationsschwierigkeiten und das gestörte Vertrauensverhältnis sind eine direkte Folge der Krise, die das Team im letzten Jahr erlebt hat. Teamleitung und Team neigen dazu, Konflikte harmonisch und beziehungsorientiert zu lösen – unter dem Motto „Wir verstehen uns doch so gut“. Dadurch wird aber manches unter den Teppich gekehrt.
- Es ist möglich, dass bereits zuvor ungelöste Konflikte bestanden. Das Entstehen der Paarbeziehung könnte ein Symptom dieser unausgesprochenen Probleme sein. Durch die Beziehung wurde es noch schwieriger, kritische Themen anzusprechen.
- Das Team hatte keine Möglichkeit, über Unsicherheiten und Probleme offen zu diskutieren. Die Konflikte stauten sich weiter an und verlagerten sich, wurden aber nicht gelöst. Sie eskalierten weiter bis zu dem Punkt, wo fast nur noch disziplinarische Maßnahmen möglich sind. Dementsprechend tief reichten dann auch die Kränkungen auf der einen Seite und möglicherweise auch Schuldgefühle auf der anderen Seite.
- Vertrauensbildende Maßnahmen können in dieser Situation nicht funktionieren. Sie führen eher zu noch mehr Misstrauen. Zunächst muss die Krise verarbeitet und die bestehenden Konflikte geklärt werden.
Meine Empfehlungen für die Teamleitung
Um ein Team erfolgreich zu führen, braucht es neben Verständnis und Fürsorge auch Abgrenzung, Klartext und manchmal Konfrontation. Die wichtigste Aufgabe einer Teamleitung besteht darin, sich aktiv um die Konflikte im Team zu kümmern. Ein Team kann sich nicht „am eigenen Schopf“ aus dem Konfliktsumpf ziehen.
Wenn die Teamleitung schwierige Themen zulässt und die Auseinandersetzung fördert, kommen die Probleme auf den Tisch. So lernt das Team, Konflikte als notwendigen Prozess des Neu-Aushandelns zu begreifen und erprobt sich darin.
Konfliktlösung ist mehr als ein Kompromiss!
Die Teamleitung sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Konflikte sind keine Katastrophe. Sie müssen nicht weg–organisiert oder weg–harmonisiert werden. Vielmehr ist es entscheidend, sie wahrzunehmen, ernst zu nehmen und das Team dabei zu unterstützen, über die kritischen Punkte und brisanten Themen zu sprechen.
Wie viel Vertrauen kann entstehen, wenn man den Mut hat, Herausforderungen offen zu besprechen?
Letztlich schafft das mehr Vertrauen als ein Teamfrühstück oder ein Betriebsausflug, die in solchen Situationen oft verkrampft wirken und das Misstrauen eher verstärken.
Besondere Team-Events sind eher etwas, um den bestehenden Zusammenhalt zu pflegen, nicht jedoch geeignete Maßnahmen, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.
Wie es weiterging
Nach zwei ausführlichen Vorgesprächen mit der Teamleitung und der Geschäftsführung wurde ein Klärungsworkshop im Team mit externer Moderation vereinbart. Dieses fand an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, wobei jeder Termin etwa sechs Stunden dauerte. Es wurde darauf geachtet, dass sich wirklich alle äußern konnten, auch die sonst eher stillen Teammitglieder.
Jeder hatte die Gelegenheit, seine Sichtweise und Erlebnisse zu teilen. Trotz unterschiedlicher Perspektiven war das Team im Gespräch miteinander.
Mit dem verbliebenen Mitarbeiter gab es viel Klärungsbedarf. Es herrschte Unmut darüber, dass die übergeordnete Behörde einbezogen wurde. Das Team fühlte sich zu Unrecht kontrolliert und hatte Sorge, nun im Blickfeld der Aufsicht zu sein.
Am Ende wurden einige Vereinbarungen bezüglich der Kommunikation untereinander sowie mit der Teamleitung getroffen. Die Rückmeldung des Teams war, dass es zwar anstrengend war, aber auch gut tat. Eine wesentliche Erkenntnis für alle war, dass sie tatsächlich in der Lage sind, anders miteinander zu kommunizieren als in der letzten Zeit. Sie fühlten sich ermutigt, wieder an ihre ursprünglichen Ressourcen anzuknüpfen.
In den folgenden Monaten fanden noch drei weitere Sitzungen statt, diesmal jedoch jeweils nur für drei Stunden. Hierbei wurde betrachtet, was bereits gut funktionierte und wo noch Verbesserungsbedarf bestand.
Für die Teamleitung war es wichtig, eine andere Art von Gesprächsführung zu erleben. Sie konnte einige Prinzipien abschauen, die ihr bei der Moderation und Strukturierung der Teamsitzungen hilfreich waren. Zusätzlich half ihr ein begleitender Coaching-Prozess, sich mehr in die Führungsrolle hineinzuwachsen und weniger beratend und pädagogisch vorzugehen.
Was heißt das grundsätzlich für Vertrauensprobleme in Teams?
Vertrauensprobleme in Teams entstehen selten aus dem Nichts. Oft verbergen sich dahinter unterschwellige Konflikte, Verletzungen oder Missverständnisse, die nie wirklich ausgesprochen oder bearbeitet wurden. In diesem Fall war es eine Paarbeziehung, die Spannungen auslöste.
Es gibt viele weitere mögliche Situationen:
- die Enttäuschung, dass eine Leitungsstelle nicht an den „Wunschkandidaten“ des Teams vergeben wurde,
- oder man selbst nicht berücksichtigt wurde, obwohl es im Raum stand,
- wenn vertrauliche Informationen ausgeplaudert werden,
- wenn sich jemand gegenüber Vorgesetzten für das Team eingesetzt hat und dann im Regen steht,
- manchmal ist es auch die Summe vieler kleiner Vorfälle und Enttäuschungen, die das Gefühl erzeugen, gegen das Unternehmen nicht anzukommen.
„Wo Menschen miteinander schaffen, machen sie einander zu schaffen.“
– Friedemann Schulz von Thun
In Teams greifen viele Ebenen ineinander: persönliche Anliegen, Rollenbilder, Aufgabenverteilung, strukturelle Spannungen und unausgesprochene Erwartungen. Vertrauen leidet dort, wo diese Ebenen nicht bewusst wahrgenommen oder in klärenden Gesprächen bearbeitet werden. Es ist Aufgabe der Führung, solche Dynamiken frühzeitig zu erkennen und Raum zu schaffen, in dem sie thematisiert werden können.
Wer bei Vertrauensverlust vorschnell zu verbindenden Maßnahmen greift, ohne zuvor die Ursachen zu klären, riskiert das Gegenteil des Gewünschten. Denn unausgesprochene Konflikte verschwinden nicht durch ein Teamfrühstück oder ein Achtsamkeitstraining. Die Absicht wird oft durchschaut – es entsteht der Eindruck, dass die Probleme umgangen oder beschönigt werden sollen. Das verschärft das Misstrauen zusätzlich, führt zu Frust und erschöpft das Team noch mehr.
Vertrauen wächst nicht auf Zuruf. Es entsteht dort, wo Schwierigkeiten ehrlich benannt, Konflikte ausgetragen und Verantwortung übernommen wird – von allen Beteiligten, aber besonders von der Leitung. Vertrauen entsteht von selbst durch die wiederholte Erfahrung, dass alle Wahrnehmungen geäußert werden können, sie respektiert und ernst genommen werden. Das Gefühl „In unserem Team/Unternehmen/Organisation geht es grundsätzlich fair zu“ ist viel wichtiger, als die Tatsache, dass den Wahrnehmungen oder Bedürfnissen entsprochen wird. Das wird oft unterschätzt.
Vertrauensbildende Maßnahmen sind dann eigentlich nur noch das Sahnehäubchen obendrauf!
Interessiert dich das Thema?
Steckst du selbst in einer schwierigen Teamsituation?
Mein Angebot für dich:
Starte mit einer fundierten Analyse – z. B. mit meinem EXPERTEN-CHECK:
Du stellst deine Fragen und erhältst eine persönliche Videonachricht mit meiner Einschätzung und konkreten Empfehlungen.
Hier geht es zum EXPERTEN-Check.
Weiterlesen
https://kerstin-pletzer.de/raus-aus-dem-team-konflikt-mit-klarungshilfe/
https://kerstin-pletzer.de/klaerungshilfe-im-team-fragen-und-antworten/
https://kerstin-pletzer.de/konfliktgespraech_fuehren/
https://kerstin-pletzer.de/konflikte-im-team-10-erprobte-tipps-fuer-fuehrungskraefte/
https://kerstin-pletzer.de/gehen-oder-bleiben-im-job/
Bildnachweis
Titel: fizkes@Getty Images



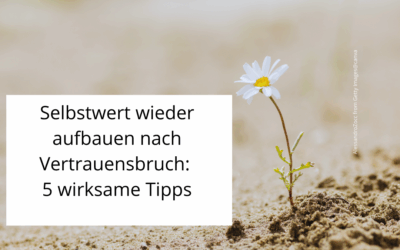

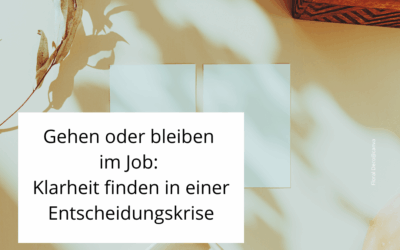
0 Kommentare