Urvertrauen. Das Wort taucht meistens dann auf, wenn etwas schiefgelaufen ist. Nach einem Vertrauensbruch. Nach einer Phase, in der nichts mehr sicher scheint. Vielleicht hat es dir gegenüber eine Freundin erwähnt, eine Therapeutin, oder du hast es in einem anderen Artikel gelesen.
Und es klingt nach etwas, das du verloren hast. Nach einem Zustand, zu dem du zurückmusst. Als gäbe es da irgendwo einen Urzustand von Vertrauen, etwas Heiles, Ursprüngliches. Etwas, das du wiederfinden kannst.
Vielleicht bist du es auch leid, ständig zu grübeln, wünscht dir, nicht immer alles anzuzweifeln, sondern Lebensmut zurückzugewinnen. Einfach rausgehen, leben, ausprobieren, ohne dieses permanente Infrage stellen und Abwägen.
Nur: Was ist das eigentlich, Urvertrauen? Und stimmt es überhaupt, dass es da einen paradiesischen Anfangszustand gab?
TL;DR
Darum geht es in diesem Text: Urvertrauen ist kein Urzustand, mit dem wir geboren werden – es entwickelt sich im ersten Lebensjahr durch Bindung. Es kann erschüttert werden, aber nicht verloren gehen, sondern es ist eine Kraft, die uns hilft, Krisen zu bewältigen. Die Vorstellung, erschüttertes Grundvertrauen ließe sich mit Selbsthilfe-Methoden alleine reparieren, ist eine Illusion. Wir brauchen andere Menschen, die uns halten; denn Krisen erfassen unser Nervensystem und bringen uns in den Überlebensmodus. Und manchmal, wenn nichts mehr geht, öffnet sich uns eine spirituelle Dimension – nicht als Bypass, sondern als Geschenk.
Was Urvertrauen wirklich ist – und was nicht
Kennst du diese Vertrauensübungen, die früher in Teams oft gemacht wurden? Fallen lassen, das schwebende Brett, das Minenfeld. Du standest vielleicht selbst mal auf so einem Podest, ließt dich nach hinten fallen und musstest darauf vertrauen, dass die anderen dich auffangen. Oder du standest in einem Kreis, ließt dich wie ein Pendel in verschiedene Richtungen kippen, während die Gruppe dich hielt.
Eine Herausforderung. Für beide Seiten. Denn Vertrauen bedeutet immer: ein Stück Kontrolle abgeben. Sich darauf verlassen, dass der andere gut damit umgeht. Und auf der anderen Seite: Verantwortung übernehmen. Halten. Da sein.
Was diese Übungen zeigen: Vertrauen ist ein Beziehungsprozess. Es entsteht nicht im luftleeren Raum. Es braucht Sicherheit in der Beziehung. Und Verantwortung auf der anderen Seite. Und genau das entwickeln wir sehr früh. Im ersten Lebensjahr.
Erik Erikson und „Basic Trust“
Der Begriff Urvertrauen geht zurück auf den deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Erik H. Erikson. Er nannte es „Basic Trust“ – Grundvertrauen. Im Deutschen wurde daraus „Urvertrauen“. Klingt schöner, poetischer – und ist genau deshalb das Problem. Denn „Ur“ suggeriert: Da war mal was. Ein Ursprung. Ein Urzustand. Als wären wir damit geboren. Als müssten wir nur zurückfinden zu diesem reinen Anfang.
Aber so sieht es die Psychologie nicht.
Aus psychologischer Sicht werden wir mit einer Fähigkeit geboren zu vertrauen. Aber nicht mit dem Vertrauen selbst. Das entwickelt sich erst. Im ersten Lebensjahr, in der Bindung zu unseren wichtigsten Bezugspersonen. Deshalb sprechen manche Forschende lieber von frühkindlichen Vertrauenserfahrungen als von Urvertrauen. Das ist nüchterner, aber genauer.
Wie Urvertrauen/Grundvertrauen entsteht
Nach Erikson durchlaufen Menschen verschiedene Entwicklungsphasen. Und die allererste Aufgabe, in den ersten ein bis anderthalb Jahren, lautet: Eine Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen finden.
Klingt einfach. Ist es nicht.
Denn es hängt komplett davon ab, was das Baby erlebt. Ob jemand kommt, wenn es schreit. Ob es gehalten wird, auch wenn es seit Stunden weint. Ob die Bezugspersonen konstant, feinfühlig, zuverlässig reagieren. Wenn die guten Erfahrungen überwiegen, entwickelt sich Grundvertrauen. Wenn nicht, dann kann eine Unsicherheit bleiben, die sich durchs Leben zieht und prägt, aber nicht festlegt.
Und das Schwierige: Niemand von uns kann sich daran erinnern. Aber es prägt uns. Weit über die Kindheit hinaus.
Je sicherer wir gebunden sind, desto stabiler wird unser Grundvertrauen. Und desto besser können wir uns auch als Erwachsene auf andere Menschen, auf neue Situationen einlassen – ohne ständig auf der Hut sein zu müssen.
Bindung ist das Fundament
Alles, was wir lernen und sind, entwickelt sich zunächst innerhalb dieser Bindung zu den primären Bezugspersonen. Später weitet sich das aus. Aber das Fundament wird früh gelegt. Die Bindungsforschung unterscheidet grob vier Bindungsstile: sicher gebunden, unsicher-vermeidend, unsicher-ängstlich-anklammernd und desorganisiert.
Und hier wird es interessant: Laut wissenschaftlichen Studien sind heute mehr als 40 Prozent der Erwachsenen nicht sicher gebunden.
40 Prozent.
Das ist keine psychologische Fußnote. Das ist eine gesellschaftliche Realität. Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn fast die Hälfte der Menschen mit einem wackeligen Fundament unterwegs ist? Wenn Angst die Grundmelodie ist, nicht Vertrauen?
Ich sehe das in meiner Arbeit immer wieder: Menschen, deren Grundvertrauen nicht stabil ist, sind unsicherer in Beziehungen. Die Kommunikation wird schwieriger – nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil so viel Angst mitspielt. Angst, die sie selbst oft gar nicht als Angst erkennen. Und Konflikte? Werden zur Bedrohung. Weil das Selbstvertrauen fehlt, sich auseinanderzusetzen, ohne die Beziehung zu gefährden.
Urvertrauen ist kein Idealzustand
Noch etwas ist wichtig: Erikson sagt, dass es nicht darum geht, nur zu vertrauen. Ein gewisses Maß an Misstrauen ist sogar nötig. Gesundes Urvertrauen bedeutet nicht: blind vertrauen. Sondern: Ich kann vertrauen. Ich habe ein Gefühl dafür, selbst vertrauenswürdig zu sein. Und ich weiß, wann Vorsicht angebracht ist.
Es geht um Balance. Nicht um Perfektion.
Aber genau das passiert gerade mit dem Begriff. Wir leben in einer Optimierungsgesellschaft, und wir machen aus allem ein Ziel, das erreicht werden muss. Auch aus Urvertrauen. Als gäbe es da einen idealen Zustand, zu dem wir zurückmüssen. Ein Optimum, das wir verfehlt haben.
Das ist Quatsch. Und es macht die Sache nur schwerer.
Im Grunde kennen wir alle dieses Gefühl. Ich spüre es, wenn ich im Wasser bin und mich einfach auf den Rücken legen kann. Treiben lassen. Oder unter Menschen, bei denen ich einfach sein kann, ohne mich anzustrengen. Dieses Gefühl: Es ist okay. Es wird schon.
Und umgekehrt: Wenn Angst da ist, fehlt genau das.
Vertrauen – der Gegenspieler von Angst
Wir denken oft, Vertrauen und Misstrauen seien Gegensätze. Das eine schließt das andere aus. Entweder oder. Aber so einfach ist es nicht.
Im Grunde ist der Gegenspieler von Vertrauen Angst. Oder anders gesagt: Vertrauen ist das Gegengift zur Angst. Wo kein Vertrauen ist, kommen Angst und Misstrauen als Folge.
Was Vertrauen wirklich bedeutet
Vertrauen bedeutet: sich auf etwas einlassen, das man nicht kontrollieren kann. Ohne zu wissen, wie es ausgeht. Das ist nicht leicht.
Ich habe das beim Klettern erlebt. Ich hatte etwas Höhenangst und musste mich trotzdem darauf verlassen, dass mein Kletterpartner mich sichert. Existenziell verlassen. Und ich habe gemerkt: Mein Vertrauen war völlig unterschiedlich, je nachdem, wer unten stand. Wie erfahren die Person war. Wie zuverlässig. Wie sicher in ihrer Persönlichkeit.
Die Angst war immer da. Aber bei manchen Menschen konnte ich trotzdem weitergehen. Bei anderen nicht.
Vertrauen ist nicht das Gegenteil von Angst. Es ist der Schritt, die Angst wahrzunehmen – und trotzdem weiterzugehen.
Alles Neue kann uns zunächst einmal Angst machen. Vertrauen ist dann der innere Schritt, trotzdem weiterzugehen. Den Moment der Angst wahrzunehmen – und dann loszulassen. Einen Schritt hinauszutun auf das Neue zu.
Je mehr wir uns trauen, je mehr Erfahrungen wir machen, desto stärker wird unser Selbstvertrauen. Und auch unser Vertrauen in das, was wir bewältigen können. Das ist kein passiver Zustand. Das ist aktiv und braucht Mut und Neugier.
Wenn das Grundvertrauen beschädigt wird
Wenn Grundvertrauen durch Vernachlässigung, Lieblosigkeit oder Missbrauch beschädigt wird, bleibt oft ein Grundmisstrauen, das durchs Leben mitgetragen wird. Ich sehe das in meiner Arbeit: Angst. Innere Anspannung. Bindungsprobleme – der Wunsch nach Nähe und gleichzeitig die Angst davor.
Aber – und das ist das Schwierige:
Angst sieht nicht immer aus wie Angst.
Sie kann daherkommen als Perfektionismus. Als Kontrollsucht. Als Hypermoralismus. Als der Wunsch, es allen recht zu machen. Als Konformismus oder als Identifikation mit Autoritäten. Alles Strategien, um mit der inneren Unsicherheit umzugehen. Um sich sicher zu fühlen, auch wenn das Fundament wackelt.
Vertrauen entwickelt sich lebenslang weiter
Und jetzt kommt etwas, das wichtig ist zu verstehen: Vertrauen entwickelt sich nicht nur im ersten Lebensjahr. Es entwickelt sich weiter. Lebenslang.
Auf jeder Entwicklungsstufe setzen wir uns mit unserer Umgebung auseinander. Mit unseren Beziehungen. Wir suchen Anerkennung, geben sie. Wir machen neue Erfahrungen – gute und schwierige. Und all das prägt unser Vertrauen weiter.
Ein gutes Grundvertrauen hilft uns, Krisen zu überwinden. Aber aus der Resilienzforschung wissen wir auch: Selbst nach schweren Traumata ist es möglich, wieder Vertrauen und Lebensmut zu entwickeln.
Kann man Urvertrauen verlieren?
Diese Frage höre ich oft. Nach einem Vertrauensbruch. Nach einem Schicksalsschlag. Wenn sich plötzlich alles unsicher anfühlt. Die Angst dahinter: Ist es jetzt für immer weg? Habe ich es verloren?
Urvertrauen wird erschüttert – nicht verloren
Nein. Aber es kann erschüttert werden.
Auch ein stabiles Grundvertrauen kann ins Wanken geraten. Durch einen Verrat in der Partnerschaft. Durch Krankheit, Verlust, Unfall. Durch Erfahrungen, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber es ist nicht weg.
Urvertrauen ist eher eine Kraft in uns. Eine, die uns hilft, mit der Erschütterung umzugehen. Die Krise zu bewältigen. Gestärkt – oder zumindest verändert – daraus hervorzugehen.
Und ich beobachte etwas: Menschen, die gerade wirklich erschüttert sind, in einer echten Krise stecken – die sind oft ganz nah dran. An dieser Kraft. Sie können die Krise nutzen, um ihr Grundvertrauen neu, vertieft zu entwickeln. Fast unabhängig davon, wie die frühe Bindungsgeschichte war.
Wobei ich nicht beschönigen will: Bei einer schwierigen Bindungsgeschichte gibt es vielleicht mehr Themen zu bearbeiten. Mehr alte Muster, die mitspielen..
Urvertrauen wiedergewinnen – was es braucht
Ich könnte dir jetzt fünf Schritte aufschreiben. Oder sieben Tipps. Eine Liste mit Dingen, die du tun kannst. Meditation. Affirmationen. Journaling. Selbstfürsorge.
Und ja – das kann helfen. Um im Alltag stabil zu bleiben. Um dich zu sortieren. Um handlungsfähig zu bleiben.
Aber wenn es um die tiefere Ebene geht – um das Grundvertrauen, das erschüttert wurde – dann reicht das nicht. Dann geht es nicht um Stabilisierung, sondern um etwas anderes. Und es wäre unangebracht, zu behaupten, man könne das alleine schaffen.
Warum der reine Selbsthilfe-Gedanke eine Illusion ist
An sich zu arbeiten ist nicht falsch. Aber zu glauben, du könntest alles alleine hinbekommen, ist gefährlich. Denn der Kern der Sache ist: Du musst dich dem inneren Schmerz stellen. Ihn fühlen, damit er vergeht. Und dafür brauchst du in der Regel andere Menschen.
Das Problem: Wenn du in einer Krise bist – nach einem Vertrauensbruch, nach einem Verlust – ist genau das verletzt. Das Vertrauen in andere Menschen. Du bist verletzt worden. Und jetzt sollst du dich ausgerechnet wieder jemandem öffnen? Dich verletzlich zeigen?
Das ist das Dilemma.
Und genau deshalb ist die Versuchung groß, es alleine zu versuchen. Durch Selbstoptimierung. Oder durch spirituelle Überhöhung. Beides sind Wege, dem Schmerz auszuweichen, statt ihn durchzufühlen.
Warum es nicht alleine geht
Es gibt einen ganz konkreten Grund, warum wir das oft nicht alleine schaffen: Krisen erfassen unser gesamtes Nervensystem. Sie bringen uns in einen Überlebensmodus – autonom, ohne dass wir das steuern können. Und in diesem Zustand haben wir keinen Zugang zu unserem klugen, erwachsenen Denken.
Deshalb brauchen auch Konflikte oft einen unabhängigen Dritten. Jemanden, der mit seiner Präsenz die Situation ein paar Hitzegrade herunterkühlt. Der es möglich macht, über Dinge zu sprechen, über die man sonst nicht sprechen könnte, weil die Emotionen zu hoch schlagen.
Wir sollten uns da nicht überschätzen.
Was wirklich hilft
Das, was uns schon als Baby geholfen hat, Grundvertrauen aufzubauen: eine Halt gebende Präsenz. Menschen, die da sind. Die aushalten, auch wenn es schwer wird.
Das muss nicht immer professionelle Hilfe sein. Manchmal reicht ein guter Freund, eine gute Freundin. Jemand, der an deiner Seite ist. Jemand, bei dem du dich zeigen kannst – mit allem, was gerade ist.
Aber manchmal reicht das nicht. Manchmal ist die Verletzung zu tief. Die Angst zu groß. Dann kann professionelle Hilfe der Weg sein – eine Therapeutin, ein Coach, eine Beratungsstelle. Auch die Telefonseelsorge. Es gibt viele Möglichkeiten für vorübergehende Unterstützung.
Ich weiß: Therapieplätze sind schwer zu bekommen. Und nicht jeder will oder kann Therapie machen. Das ist okay. Die Frage ist nicht: Therapie oder nicht. Die Frage ist: Wie verbunden kannst du dich noch fühlen? Wie viel Halt hast du, um die Gefühle, den Schmerz durch dich durch zu lassen?
Manchmal geht das alleine. Oft ist es besser, wenn jemand dabei ist.
Die spirituelle Dimension
Psychologisch gesehen entsteht Urvertrauen in der Kindheit. In der Bindung. Es entwickelt sich durchs Leben weiter. Doch da ist noch eine andere Ebene.
Die psychologische Perspektive ist wichtig. Unverzichtbar. Ohne sie zu verstehen, fehlt das Fundament. Aber die spirituelle Dimension gehört für mich auch dazu – allerdings nicht als Abkürzung. Nicht als „Higher Self“, zu dem ich mich einfach mal schnell verbindet. Nicht als spirituelle Selbstoptimierung.
Es ist nichts, das man aktiv machen kann. Es öffnet sich eher. Und dieses Öffnen passiert oft nicht freiwillig – sondern in Momenten, wo unser Handlungsrepertoire nicht mehr reicht. Wo wir mit dem, was wir bisher konnten, nicht weiterkommen. Wo etwas unsere eigenen Kräfte übersteigt. Wo die eigenen Konzepte zusammenbrechen.
Deshalb sind Menschen in Krisen manchmal so nah dran. Und genau das ist auch der Kern spiritueller Traditionen: sich darin zu üben, die innere Welt zu erkunden. Die alten Muster loszulassen. Immer wieder neu auf Situationen zu schauen.
Jetzt kommt ein Begriff, bei dem vielleicht einige innerlich abwinken: Gottvertrauen. Ich weiß. Für viele ist das belastet. Durch Kirche, durch religiöse Erziehung, durch Enttäuschung. Vielleicht denkst du: Das ist nichts für mich, ich bin nicht religiös.
Trotzdem bitte ich dich, kurz dranzubleiben. Es geht nicht um Kirche. Nicht darum, dass du an einen bestimmten Gott glauben musst. Es geht um etwas anderes.
Gottvertrauen – oder wie immer du es nennen willst
Gottvertrauen – oder Vertrauen ins Leben, ins Universum, in eine größere Kraft – gibt es in allen Religionen. Es bedeutet: Der Mensch vertraut Gott und legt sein Schicksal in dessen Hände. Ein Vertrauen darauf, dass es gute, höhere Mächte gibt. Dass letztlich das Gute siegt. Dass hinter allem ein tieferer Sinn steckt. Dass man geführt ist. Und dass man das, was man nicht selbst lösen kann, an Gott oder eine höhere Kraft oder das Universum abgeben kann.
Wer aktiv einen Glauben praktiziert, für den ist das vielleicht selbstverständlich. Aber viele Menschen tun das nicht. Durch die Aufklärung haben wir uns an der Wissenschaft orientiert. An dem, was sichtbar und beweisbar ist.
Und trotzdem bleibt die Frage: Was trägt uns, wenn nichts mehr trägt?
Wenn sich etwas öffnet
Ich habe das selbst einmal erlebt, in einer aussichtslosen Pflegesituation in der Familie. Ich hatte alles versucht, die Betreuung zu Hause zu gewährleisten. Alles, was unser Gesundheits- und Sozialsystem zur Verfügung stellt. Und dennoch war irgendwann ein Punkt erreicht, wo nichts mehr ging. Auch bei mir selbst waren die Grenzen meiner Kräfte erreicht.
Ich habe meine Not und Verzweiflung über die Situation in den Raum gesprochen. Gerichtet an ein imaginäres Gegenüber, das ich in dem Moment gar nicht hätte benennen können. Es war absurd. Und gleichzeitig das Einzige, was sich richtig anfühlte. Als würde allein das Aussprechen etwas erleichtern.
Was sich am nächsten Tag ergeben hat – ein Betreuungsplatz, den niemand voraussehen konnte – mag Zufall gewesen sein. Ich weiß es nicht.
Aber was ich gemerkt habe: In mir hatte sich etwas formiert: die Fähigkeit, eine unlösbare Situation abzugeben. Das war neu. Das war keine Technik. Keine spirituelle Praxis. Es kam, als nichts mehr ging.
Das ist vielleicht Gottvertrauen. Nicht als Abkürzung. Nicht als Bypass, um den Schmerz zu vermeiden. Sondern als etwas, das sich öffnet, wenn wirklich alles zusammenbricht, wenn die eigenen Konzepte nicht mehr tragen. Das kann man nicht machen. Es wird gegeben.
Und vielleicht – das ist meine Vermutung – hängt es zusammen mit dem, was wir ganz früh erlebt haben. Diese Erfahrung: sich öffnen, empfangen, gehalten werden. Das Muster von Urvertrauen. Die Fähigkeit, mich hinzugeben, auch wenn ich nicht weiß, was kommt. Das könnte auch wirksam sein in unserer Verbindung zur Welt selbst. Zum Größeren. Wenn wir existenziell bloß dastehen und nicht weiter wissen – und sich dann doch eine Tür öffnet.
Weiterlesen
https://kerstin-pletzer.de/vertrauensbruch-so-gewinnst-du-boden-unter-den-fuessen/
https://kerstin-pletzer.de/vertrauen-brechen-warum-tun-menschen-das/
https://kerstin-pletzer.de/vergeben-oder-verzeihen/
https://kerstin-pletzer.de/gesellschaftlicher-vertrauensverlust/
Bildnachweis:
Titel: Person Floating on Water by Scopio Images@canva

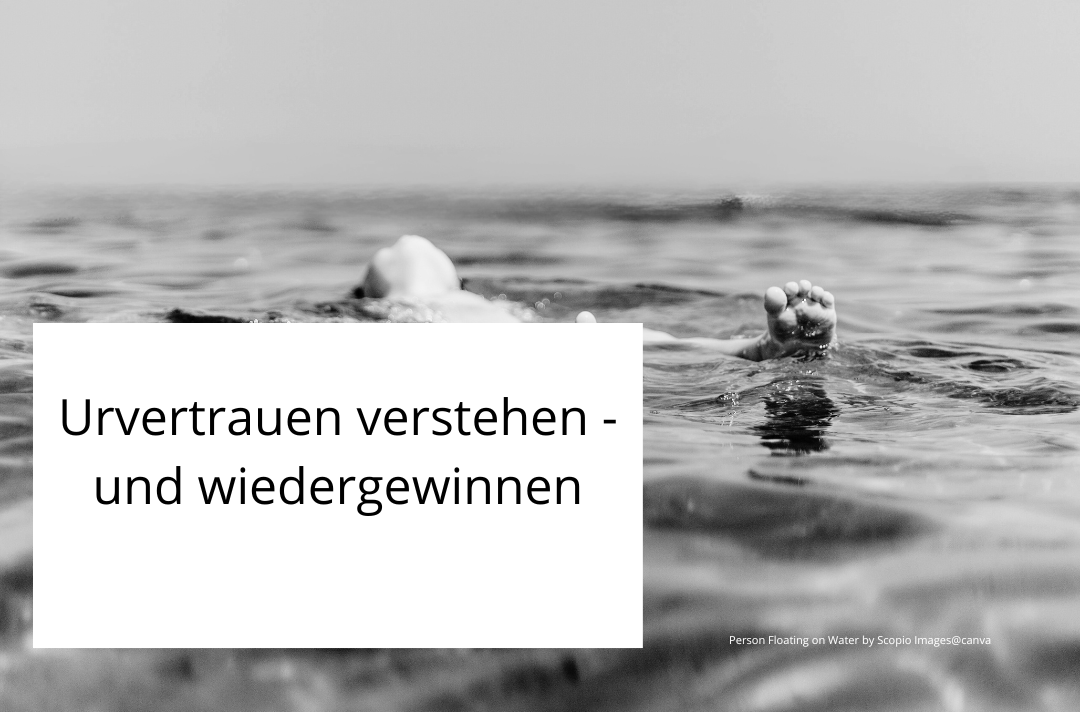

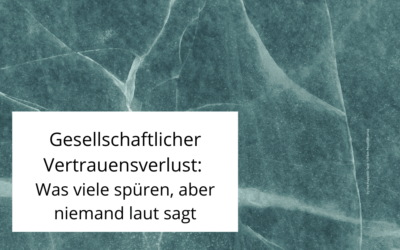


0 Kommentare