Selbstwertgefühl wieder aufbauen nach einem Vertrauensbruch bedeutet, dir selbst wieder zu vertrauen – auch wenn die Beziehung zu anderen erschüttert wurde.
Ein Vertrauensbruch trifft uns mehrfach: Er zerstört das Vertrauen in den anderen, in die Beziehung und lässt zugleich Zweifel an uns selbst zurück. Plötzlich stellen sich Fragen wie: „Hätte ich das merken müssen? Bin ich zu naiv gewesen? Was ist falsch an mir?“ Solche Gedanken nagen am Selbstwertgefühl und machen den Schmerz noch größer.
Gerade deshalb ist es so wichtig, den Blick wieder auf dich selbst zu richten. Dein Selbstwertgefühl entsteht nicht durch die Bestätigung anderer, sondern durch den Umgang mit dir selbst – besonders dann, wenn es schwierig ist.
Die folgenden fünf Tipps zeigen dir, wie du dein Selbstwertgefühl nach einem Vertrauensbruch, einer Vertrauenskrise oder einer Vertrauensverletzung Schritt für Schritt wieder aufbaust.
Jeder Tipp enthält zwei konkrete Coaching-Impulse, die du sofort ausprobieren kannst.
Und so gehst du am besten vor:
Lies zu Beginn alles einmal durch. Schau, was dich spontan anspricht.
Was zieht dich an? Worauf hättest du jetzt gerade Lust? Was könnte ein erster Schritt sein?
Fang genau damit an. Weniger ist auch hier oft mehr. Oft reicht schon ein neuer Impuls oder eine neue Perspektive.
Wenn du an einer Stelle beginnst, dich stärker zu fühlen, zieht das automatisch weitere Schritte nach sich, die wiederum auf dein Selbstwertkonto einzahlen.
Dann wünsche ich dir gute Erfahrungen!
#Tipp 1: Lasse deine Gefühle zu
Ein Vertrauensbruch löst eine Welle an Gefühlen aus: Wut, Enttäuschung, Scham, Traurigkeit. Manche sind so stark, dass sie sich körperlich bemerkbar machen – als Druck in der Brust, Enge im Hals oder Anspannung im Bauch. Andere zeigen sich eher diffus und lassen sich kaum benennen.
Emotionen sind biochemische Reaktionen deines Körpers, Signale, die dich hinweisen, dass etwas für dich wichtig oder bedeutsam ist.
Eine emotionale Reaktion ist eine innere Bewegtheit. Laut der 90-Sekunden-Regel der Neurowissenschaftlerin Dr. Jill Bolte Taylor dauert sie etwa 90 Sekunden, um ihren Höhepunkt zu erreichen, um sich dann wieder aufzulösen.
Hält eine Emotion länger an, liegt das oft daran, dass wir sie unbewusst durch Grübeln, Wiederholen oder Verweilen in dem Gefühl selbst am Leben erhalten.
Gefühle zuzulassen bedeutet nicht, sich in ihnen zu verlieren oder sie zu verdrängen.
Es bedeutet, sie wahrzunehmen, zu benennen und sie durch uns hindurchziehen zu lassen – ohne sich mit ihnen zu identifizieren. „Da ist Wut“ ist etwas anderes als „Ich bin wütend“. Ein Gefühl will gefühlt und wahrgenommen werden, sonst wird es immer größer und stärker.
Wenn du seine Botschaft verstanden hast, ist seine Funktion erfüllt, und es kann gehen.
Schwierig ist es allerdings, wenn du weiterhin Kontakt zu der Person hast, die dein Vertrauen verletzt hat. Das kann wie ein permanenter Angst-Trigger wirken. Entweder, weil dein inneres Alarmsystem dauerhaft auf Rot steht, selbst wenn objektiv keine Gefahr besteht.
Oder, weil dein Gegenüber tatsächlich weiter unklar, geheimnisvoll oder unehrlich ist. In dem Fall ist dein Gefühl ein wichtiger Warner, den du ernst nehmen solltest. In diesem Fall lies direkt einmal hier und hier.
Dauer-Alarm ist in jedem Fall Dauer-Stress. Er schwächt dich und erhöht die Wahrscheinlichkeit neuer Konflikte.
Hier liegt aber auch der Schlüssel: Es ist DEINE Reaktion. Der Alarm kann, muss aber nicht mit dem Verhalten des anderen zu tun haben. Stehe zu deinen Gefühlen, nimm sie ernst, aber schiebe die Verantwortung nicht dem anderen zu.
Ein kurzes Beispiel aus dem Alltag verdeutlicht, wie das aussehen kann:
- Impulsiver Gedanke: „Er geht heute Abend alleine raus. Ich drehe am Rad. Wer weiß, was da passiert … Ich halte das nicht aus!“
- Regulierte Reaktion: „Da ist Angst und Druck in der Brust. Ich merke, dass ich ständig daran denke, was passieren könnte. Das Gefühl will mich schützen, und mich warnen. Ich sehe aber auch, dass er mir sehr konkrete Zugeständnisse gemacht hat. Ich möchte mich entscheiden, das auszuhalten.„
Was du tun konkret tun kannst
Gefühle benennen
Nimm dir einen Moment, atme ruhig ein und aus und frage dich: „Was genau fühle ich gerade?“ Gib dem Gefühl einen Namen: „Da ist Wut.“ „Da ist Traurigkeit.“ „Da ist Scham.“ Schon das Benennen schafft Distanz – du bist nicht deine Emotion, du beobachtest sie.
2. Körper-Check
Spüre nach, wo im Körper sich das Gefühl zeigt. Vielleicht als Druck im Bauch, Kloß im Hals oder Spannung im Nacken. Lege die Hand dorthin, atme bewusst in diese Region. Mit jedem Ausatmen stell dir vor, dass die Spannung etwas weicher wird.
Indem du lernst, deine Emotionen wahrzunehmen, sie zu benennen und körperlich zu regulieren, stärkst du dein Selbstwertgefühl. Du bist nicht Spielball deiner Gefühle – du bist derjenige, der entscheidet, wie er mit ihnen umgeht.
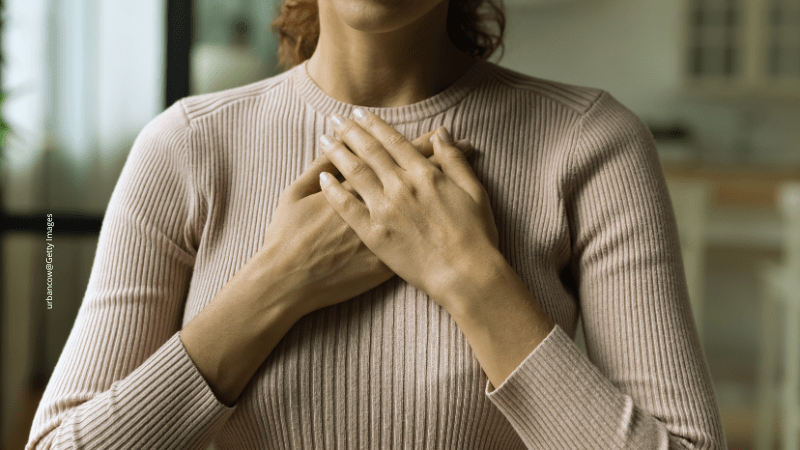
#Tipp 2: Selbstmitgefühl – dir selbst ein guter Freund sein
Nach einem Vertrauensbruch kann es passieren, dass wir zusätzlich hart mit uns selbst ins Gericht gehen. Der innere Kritiker meldet sich: „Was war ich blöd/dumm/naiv ...“ , “Was stimmt mit mir nicht, dass mir so etwas passiert…“
Der innere Kritiker will nichts Schlechtes. Er will dich einfach nur vor erneuten Verletzungen schützen. Aber wenn er Oberhand gewinnt, nagen die Gedanken am Selbstwertgefühl und verstärken Scham, Rückzug und Hilflosigkeit.
Du musst eine zusätzliche Stimme aktivieren, die auch in dir ist, nur vielleicht im Moment etwas im Hintergrund: das Selbstmitgefühl.
Selbstmitgefühl ist das wirksamste Gegenmittel.
Es bedeutet, dir selbst in schwierigen Momenten mit Güte zu begegnen – so wie du es bei einer guten Freundin oder einem guten Freund tun würdest.
Selbstmitgefühl ist kein Freibrief, Verantwortung abzugeben oder Probleme schönzureden. Es ist eine Haltung, die sagt: „Mir ist etwas passiert – ich bin nicht das Problem.“ Du bist ein Mensch, dem etwas Schmerzhaftes widerfahren ist – und der trotzdem die Möglichkeit hat, zu lernen, zu wachsen und neue Wege zu gehen.
Hier, ein Beispiel, wie das aussehen kann:
Kritische Stimme: „Du bist schuld, dass das passiert ist. Hättest du besser aufgepasst, wäre es nicht so weit gekommen“.
Mitfühlende Stimme „Was geschehen ist, tut weh. Aber Fehler oder Verletzungen definieren nicht meinen Wert. Ich darf freundlich mit mir umgehen“.
Diese Haltung schützt dich davor, im Dramadreieck aus Opfer, Täter und Retter stecken zu bleiben.
- Sie reduziert Scham und Selbstabwertung.
- Sie fördert emotionale Stabilität und Resilienz.
- Sie verhindert, dass du deinen Selbstwert von der Beziehung oder vom Verhalten anderer abhängig machst.
- Sie schafft innere Freiheit, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, ohne dich mit Schuldgefühlen zu überladen.
Selbstmitgefühl bedeutet, deine Bedürfnisse ernst zu nehmen – und nicht alles zu tun, nur um eine Beziehung um jeden Preis zu erhalten. Es geht darum, dir selbst treu zu bleiben, auch wenn die äußeren Umstände schwierig sind.

Was dir dabei helfen kann
1. Die Übung „Guter Freund“
Stell dir vor, ein guter Freund oder eine gute Freundin würde dir genau deine Geschichte erzählen.
Was würdest du ihm oder ihr sagen? Würdest du Vorwürfe machen – oder würdest du Verständnis, Trost und Zuspruch geben?
Schreibe diese Worte auf und lies sie dir selbst vor.
2. Ein innerer Selbstmitgefühls-Satz
Lege eine Hand auf dein Herz, schließe die Augen und sprich langsam:
„Es ist schwer, was passiert ist. Es tut weh. Aber ich bleibe mir ein guter Freund.“
Wiederhole diesen Satz dreimal. Spüre, wie sich dein Körper entspannt.
Wenn dir dieser Satz nicht behagt, suche dir einen, der für dich stimmig ist.
Selbstmitgefühl ist wie ein „Gegengift“ zu dem, was von außen an Misstrauen, Kritik oder Verletzung auf dich einwirkt. Es hält dich stabil in Momenten, in denen dein Selbstwertgefühl ins Wanken gerät. Wenn du dir selbst ein guter Freund bist, brauchst du dich nicht über Anpassung oder Selbstaufgabe zu definieren – und genau das macht dich stark.
#Tipp 3: Stärken und Ressourcen aktivieren
Nach einem Vertrauensbruch liegt der Blick oft wie fixiert auf dem, was fehlt: Die zerstörte gemeinsam Geschichte, die Enttäuschung, die Schuldfragen. In dieser Fixierung gerät leicht in Vergessenheit, was alles schon da ist: deine Fähigkeiten, deine Erfahrungen, deine Widerstandskraft.
Gerade in Krisenzeiten wirkt der innere Filter oft wie ein Defizit-Vergrößerungsglas. Doch das Selbstwertgefühl stabilisiert sich nicht durch das ständige Wiederholen von Defiziten, sondern durch den bewussten Kontakt mit Ressourcen.
Warum du gerade jetzt auf deine Stärken solltest
- Sie unterstützen deine Selbstwirksamkeit: „Ich kann handeln, auch wenn es schwer ist.“
- Sie reduzieren Ohnmacht und Opfergefühle.
- Sie zeigen dir, dass deine Persönlichkeit mehr ist als die aktuelle Verletzung.
- Sie schaffen Anknüpfungspunkte, wie du mit eigenen Mitteln die Krise bewältigen kannst.
Das bedeutet nicht, die Krise schönzureden oder zu leugnen. Es bedeutet, den Blick zu weiten: „Ja, es schmerzt – und zugleich gibt es auch Kräfte in mir, die tragen„.
Hier ein Beispiel aus dem Alltag:
- Reaktion im Krisenmodus: „Ich kann nicht mehr, ich halte das nicht aus.“
- Reaktion im Ressourcenmodus: „Ich erinnere mich, dass ich auch nach der Enttäuschung vor Jahren wieder aufgestanden bin. Damals hat mir meine Ausdauer geholfen. Diese Stärke habe ich auch jetzt.“
Was dir konkret helfen kann
1. Eine Stärkenliste erstellen
Nimm dir Zeit, zehn Eigenschaften, Fähigkeiten oder Werte aufzuschreiben, die dich ausmachen. Zum Beispiel: Zuverlässigkeit, Klarheit, Kreativität, Empathie, Zähigkeit, Durchhaltevermögen.
Notiere dazu, wo diese Stärken in deinem Alltag sichtbar werden. Hänge die Liste an einen Ort, an dem du sie regelmäßig siehst.
2. Dir bewusst machen, was du alles schon bewältigt hast
Erinnere dich an zwei bis drei schwierige Situationen aus deiner Vergangenheit, die du erfolgreich gemeistert hast. Schreibe dazu:
- Was war die Herausforderung?
- Welche Stärke hat mir damals geholfen?
- Wie kann ich diese Stärke heute nutzen?
3. Einen Erinnerungsanker verwenden
Lege dir ein Symbol für deine Stärken zurecht – etwa einen Stein oder ein Schmuckstück.
Sehr gut können Kindheitsfotos funktionieren, wo du stark und selbstbewusst aussiehst.

Verknüpfe diesen Gegenstand bewusst mit einer Erinnerung an eine bewältigte Herausforderung. Trage oder berühre ihn, wenn dich Selbstzweifel überfallen. Hänge oder stelle dir dein Bild an eine gut sichtbare Stelle. So rufst du deine Ressourcen auch sinnlich abrufbar ins Bewusstsein.
Indem du dich an deine Stärken erinnerst und sie bewusst nutzt, verändert sich dein innerer Dialog.
Dein Selbstwertgefühl hängt dann nicht mehr nur daran, ob andere dich bestätigen oder enttäuschen. Es gründet sich auf etwas Stabileres: dein Wissen, dass du schon vieles bewältigt hast – und dass diese Kraft in dir weiterhin vorhanden ist.
#Tipp 4: Grenzen setzen und Autonomie zurückgewinnen
Ein Vertrauensbruch bringt nicht nur Schmerz, sondern auch Verunsicherung in der Beziehung. Nähe und Distanz geraten aus dem Gleichgewicht: Einerseits der starke Wunsch, dass „alles wieder gut wird“. Andererseits die Unfähigkeit, das Geschehene einfach zu vergessen.
Daraus entsteht oft ein extremes Wechselbad der Gefühle: Nähe gibt für kurze Zeit Sicherheit, macht aber auch verletzlich. Distanz schützt, verstärkt aber die Angst, dass die Beziehung nicht mehr tragfähig ist.
Grenzen signalisieren Selbstachtung: „Ich nehme mich ernst.“
Sie verhindern Selbstaufgabe, auch wenn die Sehnsucht nach Harmonie groß ist.
Es entsteht Klarheit für dich und dein Gegenüber.
Du machst deine Autonomie spürbar – auch in einer belasteten Beziehung.
In diesem Spannungsfeld ist Grenzen setzen ein zentraler Schritt, um dein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Grenzen sind keine Mauern, sondern Markierungen: „Hier beginnt mein Bereich, hier achte ich auf mich.“
Sie machen dich handlungsfähig, egal ob du die Beziehung fortführst oder nicht.
Eine Trennung oder ein Kontaktabbruch ist einerseits eine starke Grenzziehung im Außen. Die Gefahr liegt hier aber darin, die Sache nur abzuhaken und nicht innerlich zu verarbeiten. Damit wärest du zu sehr in Distanz – in diesem Fall zu dir und dem real vorhandenen Schmerz.
Wenn der Kontakt bestehen bleibt, ist es etwas anders: Nähe und Distanz spielen sich weiterhin in der Beziehung ab. Eine gute Beziehung hat immer beides – und beide Partner können ihr Bedürfnis nach Nähe, aber auch ihr Bedürfnis nach Distanz leben. Letztlich bedeutet das, Nähe zu zu lassen, ohne sich selbst aufzugeben. Das ist nach einer Vertrauensverletzung doppelt schwierig, Weil sich kein Bedürfnis mehr neutral anfühlt, und immer sofort ein Verdacht im Raume steht: „Du sagst nicht alles“ – „Du musst permanent kontrollieren.“
Dennoch braucht jede Beziehung Grenzziehungen.
Der amerikanische Paartherapeut David Schnarch nennt das Differenzierung: Reife Beziehung entsteht nicht durch Verschmelzung, sondern durch die Fähigkeit, Spannungen auszuhalten. Konflikte sind in dem Sinn kein Defekt, sondern Wachstumsimpulse.
Hier wieder ein Beispiel für den Unterschied im Denken und Fühlen:
- Impulsiver Moment: „Wenn er mir jetzt nicht sofort verspricht, dass alles wieder wie früher wird, verlasse ich ihn.“
- Grenzbewusste Reaktion: „Ich bemerke meine Angst und meine Sehnsucht nach Sicherheit. Gleichzeitig weiß ich, dass ein leeres Versprechen nichts verändert. Deshalb setze ich die Grenze: Ich bleibe nur im Gespräch, wenn Ehrlichkeit möglich ist.“
Grenzen setzen bedeutet, zu seinen Gefühlen und Bedürfnissen, einen guten Kontakt zu haben und vor allem auch zu Ihnen zu stehen. Das kann ein Nein bedeuten und auch ein Verzicht auf Anpassung nur um eines vorübergehenden Gefühls von Sicherheit willen.
Was dir helfen kann
1. Dein persönliches Ampelsystem anlegen
Die Innere Ampel ist ein einfaches Werkzeug, das dir hilft, deine Gefühle in Stressmomenten einzuordnen und angemessen zu reagieren.
Am besten bereitest du dich darauf vor, indem du dir drei Farben und ihre Bedeutung im Voraus bewusst machst – etwa indem du sie aufschreibst oder dir kleine farbige Karten anlegst.

Übe zunächst in ruhigen Situationen, deine aktuelle Stimmung einer Farbe zuzuordnen. So fällt es dir später in belastenden Momenten leichter, die Ampel innerlich abzurufen und entsprechend zu handeln.
- Rot – Überflutet: Du bist emotional überladen. In diesem Zustand macht es keinen Sinn, weiterzureden oder zu entscheiden. Wichtig ist, bewusst eine Pause einzulegen, tief zu atmen oder Abstand zu nehmen.
- Gelb – Unsicher: Du spürst Verunsicherung oder Schwanken. Jetzt geht es darum, innezuhalten und dir selbst Fragen zu stellen: „Was passiert gerade mit mir? Was brauche ich?“ Erst, wenn du Klarheit hast, triffst du eine Entscheidung.
- Grün – Stabil: Du fühlst dich ausreichend ruhig und sicher. In diesem Zustand kannst du Nähe zulassen, Gespräche führen oder konstruktiv handeln.
Indem du die Innere Ampel regelmäßig einsetzt, trainierst du deine Selbstwahrnehmung und schützt dein Selbstwertgefühl in Situationen, die dich sonst schnell überfordern würden.
2. Dich zumuten üben
Formuliere deine Bedürfnisse klar, aber ohne Kontrolle einzufordern:
- Fordern: „Du musst endlich mal ehrlich sein!“
- Sich zumuten: „Ehrlichkeit ist mir wichtig. Deshalb sage ich offen, dass ich Transparenz brauche – auch wenn das für dich unangenehm sein kann.“
Mit einer Zumutung riskierst du, dass dein Gegenüber nicht so reagiert, wie du es dir wünschst. Aber du bleibst dir selbst treu – und genau das stärkt dein Selbstwertgefühl.
3. Kleine Grenzen und Nein’s erproben
Übe, kleine Grenzen zu setzen – auch außerhalb der Beziehung. Sage bewusst „Nein“ zu einer Bitte, die dich überfordert. Verschiebe ein Telefonat, wenn dir die Energie fehlt. Erlaube dir, deine Zeit und Aufmerksamkeit nicht selbstverständlich verfügbar zu machen. Jede gesetzte Grenze ist ein Signal: „Ich bin wichtig.“
Grenzen geben dir Autonomie zurück. Sie schützen dich davor, in der Dynamik von Nähe und Distanz verloren zu gehen. Und sie zeigen dir selbst wie deinem Gegenüber: Dein Selbstwertgefühl ist nicht verhandelbar.
#Tipp 5: Für neue Erfahrungen sorgen
Ein Vertrauensbruch zieht den Blick stark nach innen: auf das Geschehene, die Verletzung, die Zweifel. Der innere Radar läuft permanent auf „Gefahrensuche“. Das Problem: Je mehr du nur um das Ereignis kreist, desto enger wird dein Handlungsspielraum – und desto schwächer fühlt sich dein Selbstwertgefühl an.
Es geht dabei nicht um Ablenkung oder Flucht. Es geht um das bewusste Setzen neuer Schritte, die nichts mit der Krise zu tun haben – kleine, alltägliche Handlungen, die dir zeigen: Das Leben ist größer als dieser eine Vertrauensbruch.
Warum neue Erfahrungen entscheidend sind
- Sie erweitern deinen Horizont jenseits der Krise.
- Sie fördern Selbstwirksamkeit – das Gefühl: „Ich kann.“
- Sie lösen den Kreislauf aus Kontrolle und Grübeln.
- Sie stärken Vertrauen in das Leben selbst, nicht nur in die Beziehung.
Besonders, wenn du in einer Partnerschaft geblieben bist, kann die Versuchung groß sein, möglichst viel mit dem Partner zu tun – aus Angst, sonst die Kontrolle zu verlieren. Doch Kontrolle schafft keine Sicherheit. Sie schwächt. Wirkliche Stärkung kommt, wenn du dich traust, eigenständige Erfahrungen zu machen.
Beispiel
- Kontrollmodus: „Wenn ich ständig in seiner Nähe bin, kann nichts passieren. Nur so habe ich Sicherheit.“
- Gestaltungsmodus: „Ich melde mich beim Yoga an. Ich stärke meinen Körper und mein Vertrauen in mich selbst. Sicherheit entsteht, weil ich handle – nicht, weil ich alles kontrolliere.“
Was dir helfen kann
1. Die 3-Neue-Schritte-Regel
Nimm dir jede Woche drei kleine neue Dinge vor: ein neues Rezept ausprobieren, ein Möbelstück umstellen, einen anderen Weg zur Arbeit gehen, eine neue Person ansprechen.
Es geht nicht um große Abenteuer, sondern um kleine Beweise: „Ich kann Neues gestalten.“
2. Dir deine Werte bewusst machen
Wähle einen deiner zentralen Werte – etwa Gesundheit, Kreativität oder Ehrlichkeit. Überlege: „Welche kleine Handlung kann ich diese Woche tun, um diesen Wert sichtbar zu leben?“ Zum Beispiel: Wenn dir Gesundheit wichtig ist, gehst du eine halbe Stunde spazieren. Wenn dir Kreativität wichtig ist, malst du zehn Minuten. Wenn die Ehrlichkeit wichtig ist, schreibst du ein paar Gedanken dazu auf. Jede gelebte Werte-Handlung stärkt dein Selbstwertgefühl.
3. Journaling
Führe ein kleines „Erfolge-Journal“. Schreibe jeden Abend drei Dinge auf, die du an diesem Tag neu oder eigenständig gemacht hast – auch wenn sie winzig erscheinen. Nach zwei Wochen hast du eine Sammlung an Belegen, dass du Schritt für Schritt dein Selbstvertrauen aufbaust.
Neue Erfahrungen sind wie kleine Investitionen in dein Selbstwertgefühl. Jede Handlung, die nichts mit dem Problem zu tun hat, weitet den Blick. Sie zeigt dir: Du bist mehr als die Verletzung. Du bist handlungsfähig, kreativ und lebendig – auch jenseits der Vertrauenskrise.

Grenzen der Arbeit an dir
Am Selbstwertgefühl zu arbeiten, ist wirksam – aber nicht, wenn du gleichzeitig in belastenden, destruktiven oder toxischen Zusammenhängen verharrst.
Dann dient all das nicht dem Aufbau von Selbstwertgefühl, sondern dem Aufrechterhalten einer Situation, die dir schadet. Ich weiß, es ist oft schwierig, weil an Beziehungen so viel dran hängt: Kinder, Finanzen, ein Haus, Freunde – gemeinsam Aufgebautes. Dennoch setzt du deine Integrität aufs Spiel, wenn du dich verleugnest und versuchst dich durch Selbstoptimierung „unverletzlich“ zu machen. Im schlimmsten Fall bezahlst du Jahre später dafür mit einer Depression.
Wir sind gleichermaßen Individuum wie Beziehungswesen. Es trifft uns tief, wenn wir in Beziehungen hintergangen, belogen oder schlecht behandelt werden. Sich davor zu schützen, ist nur gesund.
In diesem Fall ist fast der wichtigste Schritt zum Wiederaufbau deines Selbstwertgefühls, dich von schädigenden Mustern und Umfeldern zu befreien. Erst dann hat innere Arbeit wirklich eine Chance, zu wirken.
Und das muss niemand alleine tun. Hier kann psychologische Beratung oder psychotherapeutische Begleitung sehr unterstützen.
Fazit: Selbstwertgefühl nach einem Vertrauensbruch wieder aufbauen
Ein Vertrauensbruch erschüttert – aber er zerstört dein Selbstwertgefühl nicht.
- Gefühle bewusst zulassen.
- Selbstmitgefühl kultivieren.
- Stärken aktivieren.
- Grenzen setzen.
- Neue Erfahrungen schaffen.
- Sich aus schädigenden Mustern und Umfeldern lösen
Diese fünf Schritte führen dich zurück zu dir selbst. Dein Selbstwert ist nicht verloren. Er ist da – und er wächst, wenn du dich selbst ernst nimmst.
Und wenn alles nicht richtig hilft?
Nutze die fünf Schritte als Orientierung, um erste Stabilität zurückzugewinnen.
Es ist ganz normal, dass ein solcher Prozess dauert, und sich zwischendurch auch anfühlt, als würde er nie aufhören Aber du musst nicht allein durch alles hindurch.
Wenn du spürst, dass du dich im Kreis drehst oder an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommst, suche dir einen Menschen, mit dem du vertrauensvoll über all das reden kannst oder therapeutische Begleitung.
Du kannst mir auch gern schreiben – ich schaue mit dir gemeinsam, welche Schritte in deiner Situation sinnvoll sind und wie ich dich unterstützen kann.
Schreibe mir einfach unter kontakt@kerstin-pletzer.de . Ich beantworte jede Mail!
Herzlichst
Kerstin Pletzer
Möchtest du weiterdenken, schreiben oder dich begleiten lassen?
Dann schau dir gern die weiteren Artikel zum Thema Vertrauen, Verletzung und innerer Heilung an oder abonniere meinen Newsletter. Ich teile regelmäßig Impulse, Fragen und Gedanken zu den Themen Kommunikation, Konfliktlösung und Beziehung.
Weiterlesen
https://kerstin-pletzer.de/vertrauensbruch-so-gewinnst-du-boden-unter-den-fuessen/
https://kerstin-pletzer.de/umgang-mit-aerger-und-wut/
https://kerstin-pletzer.de/betrogen-und-jetzt/
https://kerstin-pletzer.de/vergeben-oder-verzeihen/
Bildnachweis
Titel: AlessandroZocc from Getty Images@canva
Den Körper berühren: fizkes fro Getty Images @canva
Herz in den Händen: Pajarosvolandophotos@canva
Junge in den 70ern: Shanina from Getty Images@canva.de
Kartenglas: Shanina from Getty Images@canva.de
Journaling: D Xine o Graphix@canva

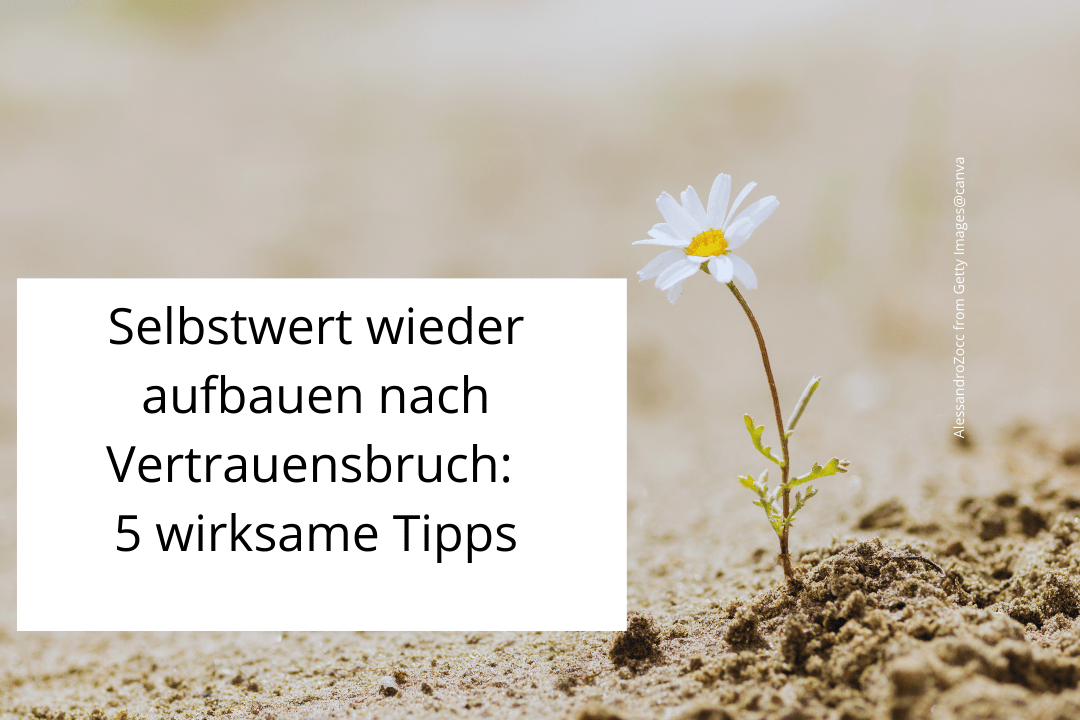


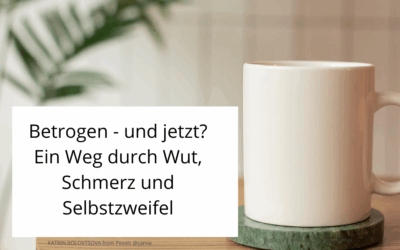

0 Kommentare